Keine Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall – Gute Idee oder der Anfang vom Ende?
Die Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall gehört zu den deutschen Errungenschaften, mit denen die deutsche Wirtschaft einst ihren Weltruf erreichte. Sie gibt den Arbeitnehmern, auch wenn sie einmal für längere Zeit ausfallen, wirtschaftliche Stabilität. Nun gab es allerdings den Vorschlag, den jeweils ersten Krankheitstag einer Arbeitsunfähigkeit von der Lohnfortzahlung auszunehmen. Die Regierung hat sich bereits dagegen entschieden. Doch wäre es grundsätzlich eine gute Idee, um die deutsche Wirtschaft zu unterstützen? Schließlich könnte man die finanzielle Belastung deutscher Arbeitgeber und das „Blaumachen“ verringern. Oder wäre das für Sie als Betriebsrat hinsichtlich des Arbeitnehmerschutzes nur der Anfang vom Ende?
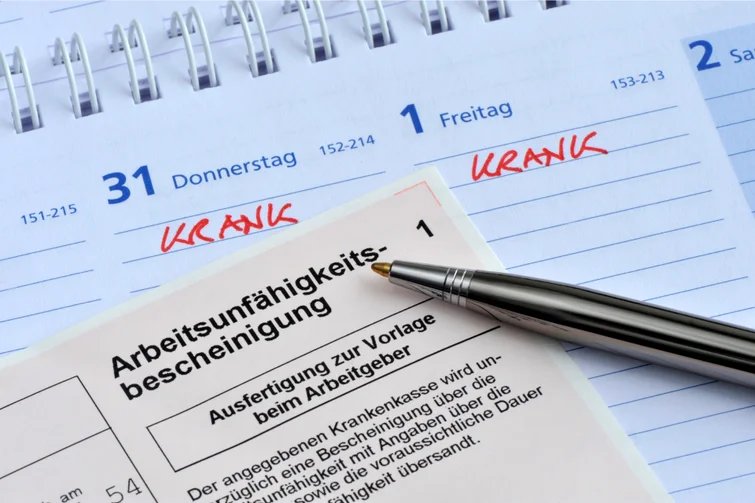
Auf hohem Niveau: Krankenstand 2024
Laut aktuellen Zahlen der Techniker Krankenkasse war im Jahr 2024 jeder Arbeitnehmer durchschnittlich rund 19 Tage krankgeschrieben. Das entspricht in etwa der Zahl aus 2023 – dem bisherigen Rekordjahr. Im internationalen Vergleich und gegenüber den Zahlen vor der Corona-Pandemie ist das ziemlich hoch.
Doch Experten warnen vor vorschnellen Schlüssen: Die Einführung der elektronischen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung in 2023 hat die Erfassung von Krankmeldungen verbessert, was statistische Anstiege erklären könnte. Zudem beeinflusst das vergleichsweise hohe Renteneintrittsalter in Deutschland die Statistik, da ältere Arbeitnehmer anfälliger für Krankheiten sind.
Entgeltfortzahlung ist eine soziale Errungenschaft
Das deutsche Modell der Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall ist klar geregelt: Nach § 3 des Entgeltfortzahlungsgesetzes (EntgFG) haben erkrankte Arbeitnehmer Anspruch auf eine Lohnfortzahlung durch den Arbeitgeber für bis zu sechs Wochen. So werden Kollegen in schwierigen Zeiten abgesichert und Vertrauen in das soziale Sicherungssystem geschaffen.
Diese Regelung ist europaweit eine der arbeitnehmerfreundlichsten. Allerdings hat sie auch ihren Preis: Laut einer Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft beliefen sich die Kosten für Arbeitgeber im Jahr 2023 auf 76,7 Milliarden Euro. Vor diesem Hintergrund kritisieren einige Unternehmenschefs das System als überholt und fordern Reformen. Anfang des Jahres hat deshalb auch Allianz-Chef Bäte die Einführung eines sogenannten „Karenztags“ ins Spiel gebracht, an dem Arbeitnehmer im Krankheitsfall keinen Lohn erhielten. Das stieß jedoch auf breiten Widerstand. Doch dazu später mehr.
Europäische Modelle: Inspiration oder Warnung?
Ein Blick ins europäische Ausland zeigt, dass es keinen einheitlichen Standard gibt. In Spanien etwa beginnt die Lohnfortzahlung erst ab dem vierten Krankheitstag und endet am fünfzehnten. In Irland wurde erst 2022 ein gesetzlicher Anspruch eingeführt. Hier gibt es aktuell lediglich drei bezahlte Krankheitstage pro Jahr – eine Zahl, die bis 2026 auf zehn Tage steigen soll. In Frankreich hingegen erhalten Arbeitnehmer in den ersten 30 Krankheitstagen 90 Prozent ihres Bruttolohns und danach zwei Drittel – tarifvertragliche Abweichungen zugunsten der Arbeitnehmer sind möglich. Die europäischen Ansätze verdeutlichen: Die Regelungen richten sich nach den jeweiligen sozialen und wirtschaftlichen Gegebenheiten.
Karenztag: Streitpunkt ohne klare Vorteile?
Zurück zu der kontrovers diskutierten Einführung eines Karenztags: Die Idee dahinter war, dass Arbeitnehmer, die nur „blaumachen“, sich die Krankmeldung zweimal überlegen würden, wenn sie am ersten Krankheitstag keinen Lohn erhielten. Kritiker halten dies jedoch für kurzsichtig.
Ein Karenztag würde vor allem Arbeitnehmer mit geringem Einkommen treffen, die sich den Verlust eines Tageslohns kaum leisten könnten. Diese würden vermutlich auch bei ernsthaften Erkrankungen zur Arbeit erscheinen, was das Risiko von Langzeitschäden und Infektionsketten erhöhen könnte. Auch Arbeitgeber hätten wenig davon, wenn kranke Mitarbeiter zur Arbeit erscheinen: Ihre Produktivität wäre eingeschränkt und sie könnten Kollegen anstecken.
Die Kritik an diesem Vorschlag kommt nicht nur von Gewerkschaften, sondern auch aus der Politik. Die Bundesminister Hubertus Heil (SPD) und Karl Lauterbach (SPD) sowie der nordrhein-westfälische Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) haben sich klar gegen den Karenztag positioniert. Sie verweisen auf die Erfahrungen aus Zeiten der Kohl-Regierung in den 1990er Jahren, in der die Entgeltfortzahlung auf 80 Prozent reduziert wurde. Diese Änderung wurde aber schnell rückgängig gemacht, da sie weder die Krankheitskosten signifikant senkte noch gesellschaftlich akzeptiert wurde. Das Thema scheint also – zumindest unter der noch amtierenden Regierung – vorerst vom Tisch zu sein.
Die Teilzeitkrankschreibung: Eine Alternative?
Als anderer Ansatz zur Reduzierung der steigenden Krankheitskosten wird die Einführung von Teilzeitkrankschreibungen diskutiert. Dieses Konzept wird unter anderem von Klaus Reinhardt, dem Präsidenten der deutschen Bundesärztekammer, befürwortet. Die Idee: Bei leichten Erkrankungen oder während der Genesung von schweren Krankheiten könnten Arbeitnehmer in reduziertem Umfang oder im Home-Office arbeiten.
Eine Teilzeitkrankschreibung würde es erkrankten Arbeitnehmern ermöglichen, sich schrittweise an die volle Arbeitsbelastung heranzutasten, ohne sich zu überfordern. Zugleich könnte sie helfen, Krankheitszeiten zu verkürzen und die Produktivität zu steigern. Voraussetzung wäre jedoch ein gesetzlicher Rahmen, der die Rechte von Arbeitnehmern und Arbeitgebern klar definiert.
Das Konzept knüpft an bestehende Regelungen wie das betriebliche Eingliederungsmanagement (BEM) an. Dieses ermöglicht bereits eine schrittweise Wiedereingliederung nach langer Krankheit.
Auch das Bundesarbeitsgericht hat im Jahr 2024 klargestellt, dass nicht jede Krankheit automatisch eine vollständige Arbeitsunfähigkeit bedeuten muss. Eine Teilzeitkrankschreibung würde diese Entwicklungen konsequent weiterführen und die Bedürfnisse moderner Arbeitswelten besser abbilden.
Ihre Rolle als Betriebsrat
Es bleibt abzuwarten, ob die neue Regierung Maßnahmen ergreifen wird. Solange hat Ihr Arbeitgeber trotzdem noch die Möglichkeit, im Betrieb eine Vorlage der Krankschreibung bereits ab dem ersten Tag der Arbeitsunfähigkeit einzuführen.
Hier ist – auch nach Auffassung des Bundesarbeitsgerichts – die Ordnung im Betrieb nach § 87 I Nr. 1 BetrVG betroffen. Ordnet das der Arbeitgeber nur für einen einzelnen Arbeitnehmer an, gibt es hingegen keine Mitbestimmung Ihrerseits.
Allerdings können Sie als Betriebsrat im Bereich der Prävention aktiv werden, insbesondere bei der Gefährdungsbeurteilung. Sie ist ein zentrales Element des Gesundheitsschutzes im Betrieb.
Und zu guter Letzt: Geben Sie Ihr Wissen auch an Ihre Kollegen weiter, um zu verhindern, dass diese aus Furcht vor Kündigung oder Gehaltseinbußen krank zur Arbeit erscheinen.









