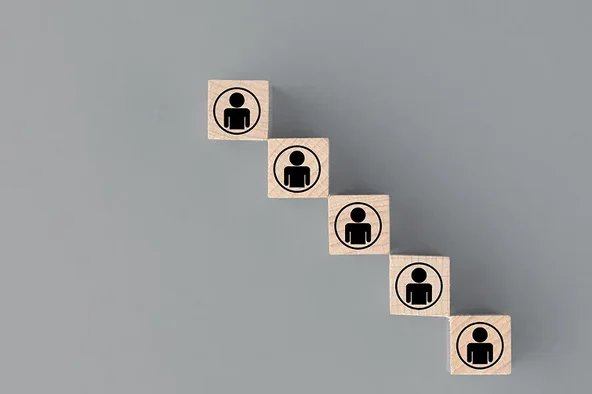Das neue Hinweisgeberschutzgesetz
Hinweisgeber übernehmen Verantwortung. Deshalb sollen ihnen auch keine Benachteiligungen drohen, vielmehr verdienen sie einen besonderen Schutz. Seit 2. Juli 2023 müssen daher Unternehmen mit 250 und mehr Beschäftigten Meldestellen einrichten, an die sich Mitarbeitende wenden können, um auf Rechtsverstöße aufmerksam zu machen. Für Unternehmen mit 50 bis 249 Beschäftigten gilt die Pflicht zur Einrichtung entsprechender Meldestellen seit dem 17. Dezember 2023.

Problemstellung und Zielsetzung
Beschäftigte in Unternehmen und Behörden nehmen Missstände oftmals als erste wahr und können durch ihre Hinweise dafür sorgen, dass Rechtsverstöße aufgedeckt, untersucht, verfolgt und unterbunden werden. In der Regel sind diese Mitarbeiter aber oftmals Anfeindungen oder Schikanen ausgesetzt, sei es durch Kollegen oder den Arbeitgeber.
Ziel des neuen Gesetzes ist der Schutz hinweisgebender Mitarbeiter vor Benachteiligungen, die ihnen wegen ihrer Meldung drohen und sie davon abschrecken können.
Was sagt das Gesetz genau?
Das neue Hinweisgeberschutzgesetz beinhaltet wichtige Anforderungen und Vorgaben an den Hinweisgeberschutz. Dazu gehören insbesondere:
Die hinweisgebende Person soll laut Entwurf wählen können, ob sie sich an eine interne oder externe Meldestelle wendet, wobei sich der Gesetzgeber eine prioritäre Orientierung zur internen Meldestelle wünscht. Die Identität der hinweisgebenden Person ist in beiden Fällen grundsätzlich vertraulich zu behandeln.
Nach einer Meldung muss die Meldestelle Folgemaßnahmen ergreifen, über diese ist die hinweisgebende Person innerhalb von 3 Monaten, in Ausnahmefällen 6 Monaten zu informieren. Dazu gehören unter anderem interne Untersuchungen, Abhilfe oder auch die Einstellung des Verfahrens. Verfahren können zwecks weiterer Untersuchungen auch an eine zuständige Arbeitseinheit oder eine Behörde (z.B. Gewerbeaufsicht, Staatsanwaltschaft) abgegeben werden.
Ganz wichtig: Für hinweisgebende Personen gilt nach einer Meldung ein Schutz vor Repressalien, also einer Benachteiligung infolge ihrer Meldung. Hierzu gehören Ausschluss von Gehaltserhöhungen ebenso wie die Nichtberücksichtigung bei Beförderungen bis hin zur Kündigung. Treten solche oder andere Benachteiligungen in engem zeitlichem Zusammenhang mit einer Meldung oder Offenlegung auf, beinhaltet das Gesetz eine Beweislastumkehr, d.h. in diesem Fall wird das Vorliegen von Repressalien vermutet und der Beschäftigungsgeber muss nun das Gegenteil darlegen und beweisen.
Die wesentlichen Änderungen zum ursprünglichen Gesetzesentwurf
Nachdem der Bundesrat das ursprünglich geplante Hinweisgeberschutzgesetz zunächst gestoppt hatte, konnte schließlich eine Einigung im Vermittlungsausschuss gefunden werden.
Die wichtigsten Änderungen gegenüber der ursprünglichen Fassung sind:
- Anonyme Hinweise müssen nicht mehr ermöglicht werden. Allerdings sieht das finale Gesetz vor, dass Beschäftigungsgeber anonyme Melde- und Kommunikationskanäle ermöglichen sollen.
- Hinweisgeber sollen (nicht: müssen) zunächst die interne Meldestelle kontaktieren, wenn es sich um Verstöße handelt, die intern behoben werden können. Externe Meldestellen sind somit nachrangig. Das verringert die Risiken von behördlichen Untersuchungen für Unternehmen.
- Das Hinweisgeberschutzgesetz ist nur bei potenziellen Verstößen, die sich auf den Arbeitgeber oder berufliche Kontakte des Hinweisgeber beziehen, anzuwenden. Das soll für Hinweisgeber klarstellen, dass andere Verstöße (z.B. Beschwerden über mangelhafte Leistungen) nicht relevant für die Meldestelle nach dem Hinweisgeberschutzgesetz sind.
- das Bußgeld bei Verstößen gegen das Gesetz wird auf maximal 50.000 Euro gesenkt. Zunächst waren 100.000 Euro vorgesehen.
Sanktionen bei Nichteinführung oder Repressalien
Im Falle der Nichteinhaltung der gesetzlichen Anforderungen sieht das Gesetz Sanktionen gegen natürliche und juristische Personen vor.
Verstöße sollen als Ordnungswidrigkeiten nach § 30 OWiG mit einer Geldbuße geahndet werden. Darunter fallen insbesondere
- das Behindern von Meldungen
- das Ergreifen von Repressalien, und/oder
- das wissentliche Offenlegen unrichtiger Informationen.
Mitbestimmung des Betriebsrats
Das Hinweisgeberschutzgesetz wird den Betriebsrat mit vielfältigen Aufgaben und Fragestellungen beschäftigen:
Beteiligung des Betriebsrats bei Einführung des Hinweisgeberschutzgesetzes
Schon bei der Einführung eines Hinweisgeberschutzsystems ist der Betriebsrat entsprechend einzubinden, da nach § 80 Abs. 2 S. 1 BetrVG der Arbeitgeber den Betriebsrat rechtzeitig und umfassend über alles zu unterrichten hat, was dieser für die Wahrnehmung seiner Aufgaben benötigt. Das soll dem Betriebsrat ermöglichen, in eigener Verantwortung zu prüfen, ob Beteiligungsrechte bestehen, gesetzliche Vorgaben eingehalten oder ob sonstige Aufgaben wahrzunehmen sind.
Mitbestimmungsrechte bei der Implementierung eines Hinweisgeberschutzsystems
Während Vorgaben, die bei der Erbringung der Arbeitsleistung selbst zu beachten sind, mitbestimmungsfrei sind, da sie das Arbeitsverhalten konkretisieren, sind Anordnungen, die das Ordnungsverhalten betreffen mitbestimmungspflichtig, vgl. § 87 Abs. 1 Nr. 1 BetrVG. Diese dienen der Sicherung eines ungestörten Arbeitsablaufs oder der Gestaltung des Zusammenlebens und -wirkens der Arbeitnehmer im Betrieb. Werden also im Zuge der Einführung eines Hinweisgebersystems die ohnehin bestehenden, arbeitsvertraglichen Hinweispflichten ausgedehnt oder Regelungen bezüglich des konkreten Meldeverfahrens eingeführt, ist das Ordnungsverhalten betroffen und der Betriebsrat ist einzubeziehen.
Im Entwurf des Hinweisgeberschutzgesetzes sind schließlich Einrichtung, Organisation und Arbeitsweise der internen Meldestelle umfassend beschrieben, beim Thema “Meldekanäle” sieht der Referentenentwurf jedoch lediglich vor, dass dem Whistleblower die Möglichkeit einzuräumen ist, die Meldung an das Hinweisgebersystem in Textform oder mündlich abzugeben. Das kann natürlich auch über ein technisches Kommunikationssystem (insbesondere Telefon) oder über digitale Kanäle erfolgen, was das Mitbestimmungsrecht des Betriebsrats nach § 87 Abs. 1 Nr. 6 BetrVG eröffnen würde.
Mitbestimmungsrechte bei der Besetzung einer internen Meldestelle
Auch bei der personellen „Ausstattung“ der Meldestelle könnten sich mitbestimmungspflichtige Tatbestände nach § 99 BetrVG ergeben, weil beispielsweise neues Personal eingestellt würde oder aber Beschäftigte zusätzlich zu ihrer „normalen“ Tätigkeit mit der Wahrnehmung von Aufgaben der Meldestelle betraut werden.